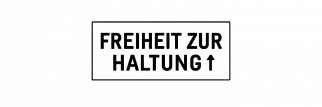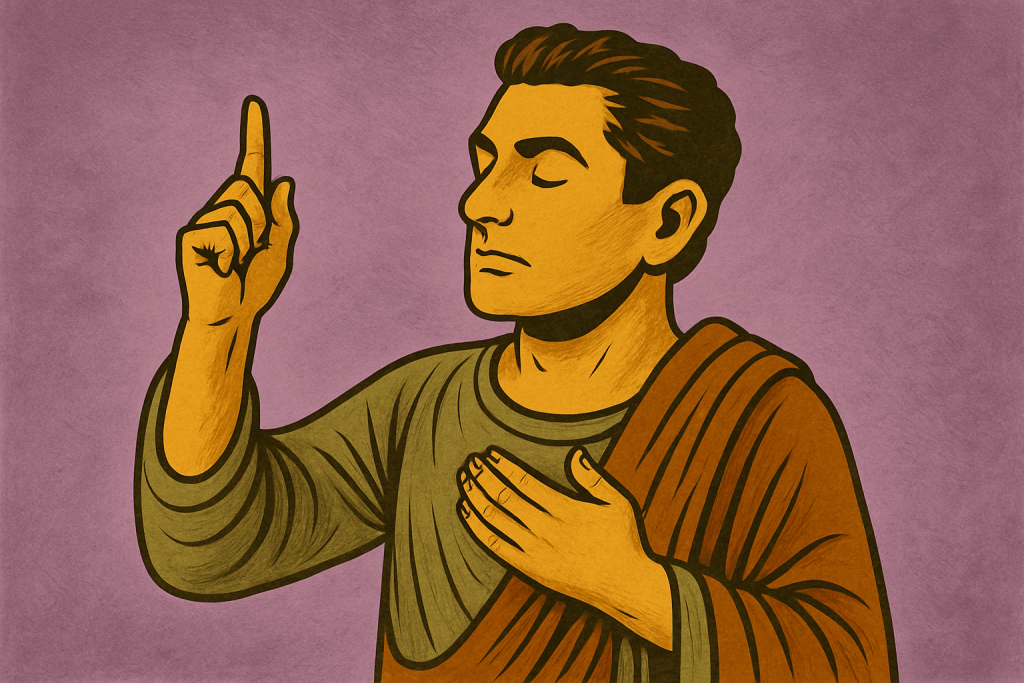Über den Unterschied zwischen Haltung und moralischer Selbstgewissheit
Moral ist wichtig – aber sie ist kein Argument. Sie gibt Orientierung, doch sie darf den Zweifel nicht ersetzen. Wo Moral zum Maß aller Dinge wird, verliert Politik ihre geistige Beweglichkeit. Aus Überzeugung wird Überheblichkeit, aus Haltung wird Selbstgerechtigkeit.
Wir erleben eine Zeit, in der moralische Lautstärke das rationale Argument verdrängt. Wer differenziert, gilt als unsensibel; wer abwägt, als zögerlich. Der öffentliche Diskurs verliert damit, was ihn ausmacht – die Bereitschaft, zwischen richtig und falsch auch das Schwierige zu sehen.
Doch Demokratie lebt vom Zweifel. Von der Kunst, zwischen Positionen zu vermitteln, ohne Prinzipien zu verraten. Wer dagegen jede abweichende Meinung moralisch bewertet, ersetzt das Ringen um Wahrheit durch die Sicherheit der eigenen Tugend. So wird der Diskurs zu einem Wettbewerb der Empörungsbereitschaft – wer am lautesten moralisiert, gilt als der Anständigste.
Politik braucht Werte, aber sie darf sich nicht in ihnen erschöpfen. Moral ohne Maß wird zur Versuchung, die Wirklichkeit zu überhöhen. Sie urteilt nicht, sie verurteilt. Und sie verhindert die Auseinandersetzung mit dem, was tatsächlich ist. Eine Gesellschaft, die sich moralisch überfordert, verliert den Blick für Proportionen – und damit für Lösungen.
Haltung bedeutet nicht, immer recht zu haben. Sie bedeutet, das Richtige zu suchen, auch wenn es unbequem ist. Doch wo Moral zur Währung wird, wird Haltung zur Inszenierung. Der moralische Gestus ersetzt die argumentative Arbeit. Am Ende zählt nicht mehr, was gesagt wird, sondern wer es sagt – und mit welcher moralischen Berechtigung.
Diese Form der Selbstvergewisserung hat etwas Tröstliches. Sie erspart das Denken, sie bietet Zugehörigkeit, sie macht aus Komplexität ein Drama mit klarer Rollenverteilung. Doch wer so argumentiert, sucht keine Lösung, sondern Bestätigung. Er verwechselt die Reinheit des Motivs mit der Richtigkeit des Ergebnisses.
Moral kann verbinden, aber auch spalten. Wenn sie sich absolut setzt, schafft sie ein neues Oben und Unten: hier die Aufgeklärten, dort die Rückständigen. Wer so denkt, glaubt nicht mehr an die Kraft des Arguments, sondern an die eigene Unfehlbarkeit. Das ist die stille Arroganz unserer Zeit – sie kommt freundlich daher, aber sie duldet keinen Widerspruch.
Eine reife Demokratie braucht mehr Demut. Sie braucht den Mut, sich der Komplexität zu stellen, statt sie zu moralisieren. Moral kann Richtschnur sein, aber nie Ersatz für Denken. Sie ist der Anfang des Diskurses – nicht sein Ende.
Echte Haltung zeigt sich nicht in Empörung, sondern in Verantwortung. Wer moralisch urteilt, ohne die Folgen zu bedenken, handelt nicht ethisch, sondern bequem. Politik braucht weniger Empörungskunst und mehr Urteilskraft. Moral mag den Anstoß geben – doch nur Argumente können überzeugen.
Moral weist den Weg, aber sie darf ihn nicht diktieren.