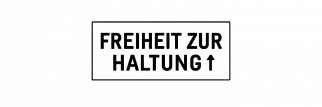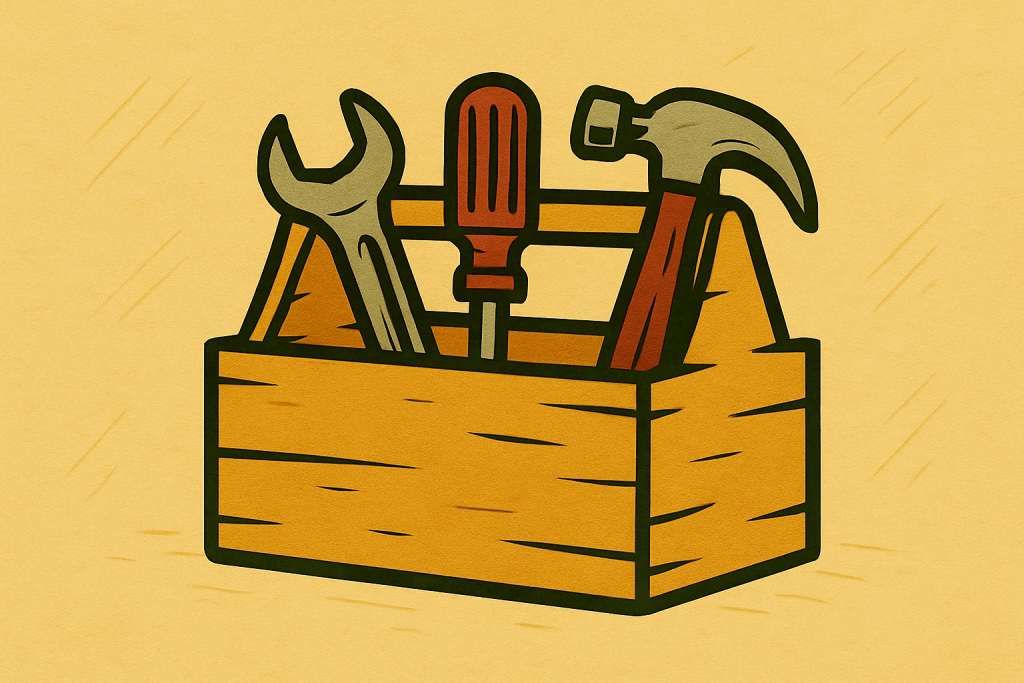Eigenverantwortung ist kein politisches Schlagwort, sondern eine kulturelle Zumutung. Sie fordert den Einzelnen – und entlastet ihn zugleich, weil sie ihm zutraut, selbst zu denken und zu handeln. Doch genau dieses Zutrauen scheint in unserer Gegenwart zu schwinden.
Die Sehnsucht nach Absicherung hat die Freiheit in die Defensive gedrängt. Sicherheit gilt als Garant sozialer Vernunft, doch sie wird leicht zur Gewohnheit, die uns das Wagnis der Eigenständigkeit abnimmt. Fürsorge wird zur Begründung des Staates, nicht mehr zur Aufgabe des Menschen.
Es liegt in der Natur jeder Gesellschaft, Schwache zu schützen und Starke zu begrenzen. Aber wenn Fürsorge zur dauerhaften Haltung wird, verliert sie ihren Sinn. Hilfe, die nicht befähigt, sondern ersetzt, entzieht dem Einzelnen jene Erfahrung, die Selbstvertrauen schafft: zu handeln, zu scheitern, zu lernen.
Freiheit braucht die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen – für das eigene Leben, für Entscheidungen, für deren Folgen. Wer Verantwortung trägt, darf Fehler machen, aber er muss sie sich eingestehen. Wer sie abgibt, verliert nicht nur seine Unabhängigkeit, sondern auch sein Maß.
In einem überversorgten Staat wächst das Misstrauen gegen die eigene Mündigkeit. Man verlangt nach Regeln, um sich sicher zu fühlen, und nach Schuldigen, wenn sie nicht genügen. So wird aus der Fürsorge ein Kreislauf der Bevormundung: Man schützt, bis nichts mehr zum Schützen bleibt, und beraubt den Einzelnen jener Selbstwirksamkeit, die jede Freiheit braucht.
Eigenverantwortung ist kein Gegensatz zu Solidarität. Sie ist ihre Voraussetzung. Nur wer sich selbst tragen kann, kann auch für andere einstehen.
Ein Staat, der seinen Bürgern Verantwortung abnimmt, entmündigt sie; ein Staat, der ihnen vertraut, stärkt sie.
Freiheit und Fürsorge stehen nicht im Widerspruch, sondern in Spannung – und genau in dieser Spannung zeigt sich die Würde des Menschen: die Fähigkeit, selbst zu entscheiden, was er will, und zu tragen, was daraus folgt.
Verantwortung ist keine Last, sondern ein Ausdruck von Selbstachtung.
Sie ist der stille Kern des Liberalismus – und vielleicht das, was unsere Zeit am dringendsten zurückgewinnen muss: das Vertrauen, dass Menschen mit Freiheit umgehen können.