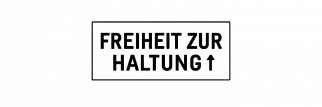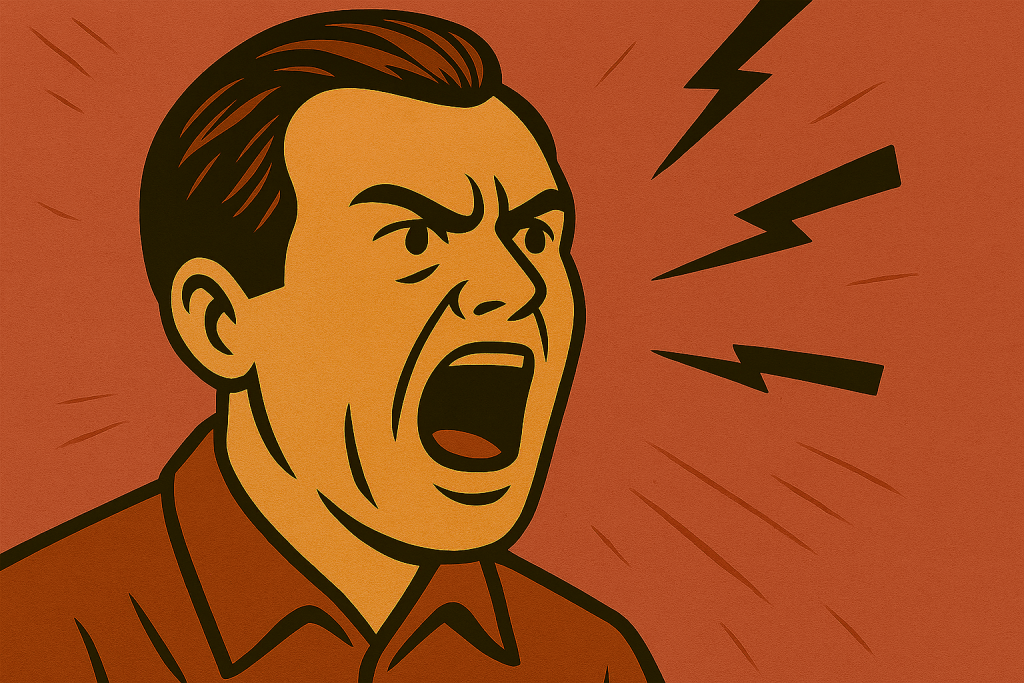Über den Verlust intellektueller Redlichkeit im Umgang mit Demokratiefeinden
Wer über Extremismus spricht, muss bereit sein, ihn auf allen Seiten zu sehen. Doch genau daran mangelt es zunehmend – nicht an Empörung, sondern an Ehrlichkeit. Der Reflex, politische Ränder moralisch zu sortieren, ist bequem, aber gefährlich. Er ersetzt Analyse durch Gesinnung und erschwert das, was Demokratie eigentlich ausmacht: Unterscheidungsfähigkeit.
Eine offene Gesellschaft darf keinen Extremismus dulden – weder den rechten noch den linken. Doch während rechte Tendenzen zu Recht scharf verurteilt werden, wird linke oder ideologisch verbrämte Intoleranz oft relativiert, weil sie sich im Gewand des Guten zeigt. Was aus Überzeugung beginnt, kippt in Selbstgerechtigkeit, wenn der Zweck jedes Mittel heiligt. Dann wird der Kampf gegen Extremismus selbst zum ideologischen Projekt – und verliert seine Glaubwürdigkeit.
Demokratie lebt vom Maß, nicht von der Moral. Sie braucht Kritik, Kontrolle und Widerspruch – auch gegenüber jenen, die sich auf die richtige Seite stellen. Wenn staatlich geförderte Projekte oder zivilgesellschaftliche Initiativen einseitig arbeiten, wenn Begriffe wie „Demokratie“, „Toleranz“ oder „Vielfalt“ zu politischen Marken werden, dann ist etwas aus dem Gleichgewicht geraten. Was gut gemeint war, verliert an Vertrauen, weil es in der Praxis nicht mehr neutral wirkt.
Die Gefahr liegt nicht in der Absicht, sondern in der Einseitigkeit. Wer Demokratie schützen will, darf sie nicht zum Werkzeug eigener Weltbilder machen. Eine offene Gesellschaft darf nie den Fehler begehen, Gesinnung zur Bedingung für Zugehörigkeit zu erklären. Wo politische Deutungshoheit wichtiger wird als rechtsstaatliche Fairness, droht aus moralischer Überlegenheit eine neue Form der Intoleranz zu werden.
Liberalismus beginnt dort, wo man dem anderen sein Anderssein zugesteht. Er lebt von Vertrauen in Urteilskraft und Eigenverantwortung – und davon, dass Freiheit auch die Freiheit des Falschen einschließt. Wer Meinungsfreiheit nur für die eigene Seite verteidigt, hat ihren Sinn nicht verstanden.
Das Aushalten von Widerspruch ist kein Zeichen von Schwäche, sondern von Stärke. Eine Demokratie, die nur Applaus zulässt, verliert ihre Widerstandskraft. Sie wird anfällig für jene, die im Namen der Moral Grenzen verschieben wollen – Schritt für Schritt, immer mit der Begründung, es diene der guten Sache.
Ausgewogenheit ist heute fast verdächtig geworden. Wer beide Seiten betrachtet, gilt schnell als unentschlossen. Doch Differenzierung ist keine Flucht vor Haltung, sondern ihr Beweis. Sie zwingt dazu, Argumente ernst zu nehmen, auch wenn sie unbequem sind.
Eine lebendige Demokratie braucht diesen Mut zur Zumutung: das Aushalten von Spannungen, das Akzeptieren von Grautönen. Sie braucht Institutionen und Stimmen, die weder moralisieren noch relativieren – sondern nüchtern bleiben, wenn andere laut werden.
Extremismus ist keine Einbahnstraße. Er ist ein Symptom dafür, dass wir den inneren Kompass verloren haben, der zwischen Meinung und Moral, Haltung und Hybris unterscheidet. Eine wehrhafte Demokratie braucht beides: Konsequenz im Schutz ihrer Prinzipien – und Selbstkontrolle im Umgang mit ihrer eigenen Macht.
Denn wer Freiheit nur für sich selbst beansprucht, hat sie schon verraten.