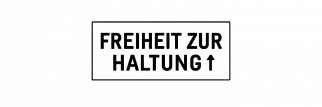Freiheit beginnt nicht mit Regeln, sondern mit einem Menschenbild, das dem Einzelnen etwas zutraut: Urteilsvermögen, Eigenverantwortung, Maß. Doch dieses Bild gerät zunehmend unter Druck. Immer häufiger wird der Mensch nicht als Gestalter, sondern als Risiko betrachtet – ein Wesen, das man überwachen, lenken, absichern muss. Der Bürger wird zum Verdacht.
Es ist ein schleichender Kulturwandel: weg vom Ermöglichen, hin zum Misstrauen. Viele Menschen haben in den vergangenen Jahren das Vertrauen in Institutionen verloren – nicht aus Bequemlichkeit oder Protestlust, sondern aus Erfahrung. Wenn Entscheidungen intransparent bleiben, Verfahren undurchschaubar werden und Verantwortung sich in Gremien auflöst, entsteht der Eindruck, dass politische Prozesse sich selbst genügen. Aus dieser Distanz wächst kein Vertrauen, sondern Resignation.
Vertrauen lässt sich nicht verordnen. Es entsteht dort, wo Verantwortung sichtbar und Sprache verlässlich bleibt. Eine Politik, die Fehler eingestehen kann, wirkt glaubwürdiger als eine, die sie verschweigt. Wer alles erklärt, aber nichts einräumt, mag überzeugen wollen – aber nicht überzeugen können. Vertrauen braucht keine Inszenierung. Es wächst im stillen Gegensatz zwischen Wort und Tat.
Der freiheitliche Staat lebt vom Zutrauen seiner Bürger. Er darf ordnen, schützen und korrigieren – aber er darf ihnen nicht das Denken abnehmen. Freiheit ist kein Zustand der Kontrolle, sondern der Zumutung: das Wagnis, dass Menschen mit Freiheit umgehen können. Wer jedes Risiko vermeiden will, entzieht der Gesellschaft die Möglichkeit, aus Fehlern zu lernen.
Freiheit ist die Einladung, Verantwortung zu übernehmen. Sie lebt von der Bereitschaft, Unsicherheit auszuhalten, und vom Mut, Vertrauen zu schenken. Nicht jeder Irrtum bedarf eines Gesetzes, nicht jede Abweichung einer Regel. Freiheit bleibt nur dort lebendig, wo Vertrauen stärker ist als Misstrauen – und wo der Staat den Menschen etwas zutraut, bevor er sie schützt.